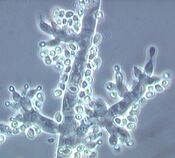Hauptseite
Willkommen bei scientia.wiki (ehemals Wikiscience)  scientia.wiki (Wikimedia-Projektvorschlag: Wikiscience; weitere TLD: freieswissen.org) ist ein freies, offenes und gemeinnütziges Wikiprojekt, das einen zentralen Raum für Wissenschaft, Forschung und Lehre im Internet bietet. Ziel ist es, wissenschaftliche Forschung für alle Menschen frei zugänglich, nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Das Projekt richtet sich an alle wissenschaftlich Interessierten und ermöglicht Nutzenden, aktiv an der Erstellung, Veröffentlichung und Diskussion wissenschaftlicher Inhalte teilzunehmen (s. u. Citizen Science). scientia.wiki fördert kollaborative Forschung, den Austausch zwischen Fachbereichen, verständliche wissenschaftliche Inhalte sowie Transparenz und Nachprüfbarkeit von Forschungsergebnissen. Es dient als Plattform für Primärforschung und Originalpublikationen, die in Wikimedia-Projekten nicht erlaubt sind, und integriert Schnittstellen zu Wikipedia, Wikiversity, Wikisource, Wikimedia Commons und Wikidata. Die Qualität der Inhalte wird durch ein offenes Peer-Review-System, überprüfbare Quellen und wissenschaftliche Standards sichergestellt. Alle Beiträge stehen unter freien Lizenzen, vorzugsweise Creative Commons. Das Projekt ist ein zentraler Bestandteil der globalen Open-Science-Bewegung und fördert freie, transparente und gemeinschaftliche Forschung getreu dem projektinternen Motto: „Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen.“ Kollaborative Wissenschaft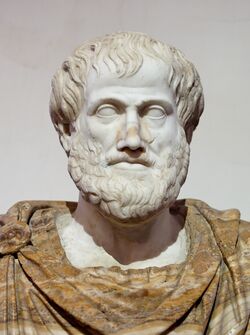 Im scientia.wiki ist die Durchführung wissenschaftlicher Primärforschung (Originalforschung) ausdrücklich zulässig, sofern sie den anerkannten wissenschaftlichen Standards entspricht und auf methodisch nachvollziehbarer sowie ethisch einwandfreier Grundlage beruht. Forschende, die sich ernsthaft und systematisch mit wissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen, werden ermutigt, ihre Projekte in der Plattformumgebung zu entwickeln, zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Darüber hinaus bietet scientia.wiki eine geeignete Struktur für die Durchführung formaler Begutachtungsverfahren (Peer Reviews). Es wird empfohlen, Projekte der Primärforschung eindeutig zu kennzeichnen, um ihre Auffindbarkeit und wissenschaftliche Einordnung zu erleichtern. Alle im scientia.wiki tätigen Personen sind verpflichtet, die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. Autorinnen und Autoren von Primärforschung sollen ihre Arbeiten einer kritischen Überprüfung durch andere Forschende unterziehen und erhaltene fachliche Rückmeldungen aktiv berücksichtigen. Zugleich wird die Gemeinschaft dazu angehalten, sich gegenseitig konstruktives und qualitätssicherndes Feedback zu geben. Methoden, Ergebnisse und Bewertungen, die im Rahmen der Primärforschung entstehen, werden dauerhaft dokumentiert und archiviert. Im Gegensatz zu den Wikimedia-Projekten, die keine Primärforschung zulassen, ist im scientia.wiki gemeinschaftliche Primärforschung nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Das Projekt versteht sich als offenes wissenschaftliches Umfeld, das die Möglichkeiten kollaborativer Forschung im digitalen Raum systematisch erprobt und weiterentwickelt. Im scientia.wiki muss jede Form der Primärforschung wissenschaftlich fundiert sein. Begutachtungen durch qualifizierte Fachpersonen gelten als zentraler Mechanismus zur Sicherstellung von Qualität, Nachvollziehbarkeit und wissenschaftlicher Integrität. Auch kritische Analysen bestehender Forschungsliteratur können neue wissenschaftliche Erkenntnisse generieren; sofern sie neuartige Schlussfolgerungen enthalten, unterliegen sie ebenfalls einem Peer-Review-Verfahren. Es wird erwogen, wissenschaftliche Forschungsarbeiten gemeinschaftlich zu verfassen. Konkret bedeutet dies, dass zum Beispiel die eigene in scientia.wiki veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit von anderen Nutzenden erweitert werden kann – ähnlich wie Artikel in der Wikipedia. Dabei sollte der grundlegende Aufbau der Forschungsarbeit unverändert bleiben, während inhaltliche Ergänzungen ausdrücklich erwünscht sind. Von diesem Verfahren wird erhofft, dass durch die Nutzung von Kollektivintelligenz neue wissenschaftliche Ideen entstehen und erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden könnten. Neben Primärforschung sind im scientia.wiki auch andere Formen wissenschaftlicher Arbeit ausdrücklich willkommen. Dazu zählen beispielsweise wissenschaftliche Artikel in Form von Wissenschaftsjournalismus, Aufsätze, Essays oder ähnliche Formate. Ziel ist es, eine möglichst vielfältige, kreative und gut dokumentierte wissenschaftliche Auseinandersetzung zu fördern. Die Plattform unterscheidet verschiedene Formen der Begutachtung. Eine erste, informelle Form entsteht durch die offene Beteiligung der Gemeinschaft, deren Aussagekraft jedoch begrenzt sein kann. Formale interne Reviews werden von anerkannten Mitgliedern der wissenschaftlichen Gemeinschaft durchgeführt und folgen einem festgelegten Verfahren. Die Ergebnisse dieser Begutachtungen werden dauerhaft mit dem jeweiligen Forschungsprojekt verknüpft und bilden eine qualifizierte Bewertung der Arbeit. Deine Mitarbeit fördert freie und offene Wissenschaft scientia.wiki lädt dich ein, aktiv an freier Forschung mitzuwirken! Hier kannst du eigene wissenschaftliche Projekte starten, Daten erheben, Hypothesen prüfen und deine Ergebnisse offen veröffentlichen. Eröffne einen Forschungsraum in deiner Disziplin, arbeite mit anderen an neuen Ideen und beteilige dich am offenen Peer-Review-System, in dem alle Arbeiten transparent geprüft und verbessert werden. Deine Forschung steht unter freien Lizenzen und bleibt damit für alle zugänglich und nachnutzbar. Lade Datensätze hoch, verknüpfe sie mit Wikimedia-Projekten und diskutiere Methoden und Ergebnisse mit anderen Forschenden. Ob du studierst, professionell forschst oder dich einfach für Wissenschaft begeisterst – bei scientia.wiki kannst du Wissen schaffen, teilen und die Zukunft der freien und offenen Wissenschaft mitgestalten.
Siehe auch:
So funktioniert deine Mitarbeit Du musst nicht studiert haben, um hier mitarbeiten zu dürfen. Wenn du dich für ein wissenschaftliches Thema interessierst und dazu bereits ernsthafte Nachforschungen angestellt hast oder noch anstellst, kannst du deine Forschung hier dokumentieren und deine Ergebnisse veröffentlichen. Entscheidend ist die „Ernsthaftigkeit deiner Arbeit und die Nachvollziehbarkeit deiner Forschung“ für die Leserschaft. Es empfiehlt sich, zunächst offline einige Notizen oder erste Textentwürfe zu erstellen, bevor du hier eine Seite anlegst.
Wenn du dich entschieden hast, deine Forschungsarbeit hier unter den Bedingungen der Creative Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0 anzulegen, kannst du wie folgt vorgehen: Gib oben in der Suchzeile den Titel deiner Arbeit ein. Drücke anschließend die Eingabetaste und klicke danach auf „Erstellen“. Du musst deine Arbeit nicht sofort fertigstellen, sondern kannst sie Schritt für Schritt in Ruhe ausarbeiten. In deiner Arbeit kannst du durchaus wissenschaftliche Begriffe verwenden, solltest diese jedoch mit Verlinkungen oder zumindest mit Anmerkungen in den Fußnoten erklären, damit auch außenstehende Personen deine Arbeit verstehen können. Versuche außerdem, in einer relativ verständlichen deutschen Sprache zu schreiben. scientia.wiki soll für alle verständlich sein. Bitte beachte, dass hier sämtliche inhaltlichen Aussagen mit entsprechenden Quellen belegt werden; unbelegte Textpassagen müssen andernfalls entfernt werden. Bei der Primärforschung gestaltet sich die Belegpflicht jedoch etwas anders: Da es sich um eine Erstuntersuchung handelt, liegen logischerweise noch keine Referenzen vor, da das Forschungsfeld neu erschlossen wird. Dennoch sollte geprüft werden, ob in der wissenschaftlichen Literatur bereits vergleichbare Untersuchungen existieren. Ganz unten auf deiner Seite solltest du zum Abschluss deine Arbeit mit der entsprechenden Hauptkategorie Wenn du deine Entscheidung später ändern möchtest, obwohl du bereits eine Arbeit angelegt hast, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, diese löschen zu lassen. Dieses Recht steht dir persönlich zu. In diesem Fall wende dich bitte an den Ansprechpartner der scientia.wiki.. Bitte beachte auch:
| |||
|
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften Die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften untersuchen die Regeln, Strukturen und Prozesse menschlichen Handelns in wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhängen. Die Wirtschaftswissenschaften analysieren Produktion, Verteilung und Konsum von Gütern und Dienstleistungen, während die Rechtswissenschaften Normen, Gesetze und deren Anwendung in der Gesellschaft erforschen. Beide Disziplinen nutzen theoretische Modelle und empirische Methoden, um Entscheidungsprozesse, Institutionen und gesellschaftliche Ordnungen zu verstehen und zu gestalten. Sie leisten einen zentralen Beitrag zur Organisation, Stabilität und Entwicklung von Gesellschaften. Interdisziplinäre Wissenschaften Interdisziplinäre Wissenschaften verbinden Methoden, Konzepte und Erkenntnisse aus mehreren Fachbereichen, um komplexe Fragestellungen ganzheitlich zu untersuchen. Sie entstehen häufig an den Schnittstellen traditioneller Disziplinen, etwa zwischen Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Ziel ist es, Probleme zu lösen, die einzelne Fachrichtungen isoliert nicht vollständig erfassen können. Beispiele hierfür sind Umweltwissenschaften, Kognitionswissenschaften oder Biotechnologie. Interdisziplinäre Ansätze fördern Innovation, vernetzen Wissen und ermöglichen umfassendere Analysen gesellschaftlicher, technischer und ökologischer Herausforderungen. Wissenschaftsforschung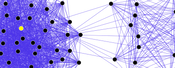 Die Wissenschaftsforschung ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das die Entstehung, Organisation, Methoden und Wirkung von Wissenschaft untersucht. Ziel ist es, die Strukturen, Prozesse und sozialen Dynamiken wissenschaftlicher Praxis systematisch zu analysieren. Sie integriert Ansätze aus der Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsphilosophie, Scientometrie und Wissenschaftsethik, um sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte wissenschaftlicher Arbeit zu erfassen. Zentrale Themen sind unter anderem Laborpraktiken, Wissenschaftskommunikation, Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sowie die Politik und Organisation von Forschung. In modernen Kontexten spielt die Analyse von Netzwerken, Big Data und digitalen Forschungspraktiken eine zunehmende Rolle, um die Dynamik, Vernetzung und Innovationsprozesse innerhalb der globalen Wissenschaft zu verstehen. Freies und Offenes Wissen Freies und Offenes Wissen (engl. Free and Open Knowledge; lat. Scientia libera atque aperta) bezeichnet Informationen, Inhalte und Daten, die uneingeschränkt genutzt, verändert, geteilt und verbreitet werden dürfen. Der Begriff umfasst sowohl den freien Zugang zu Wissen als auch die Möglichkeit, dieses Wissen zu bearbeiten, weiterzugeben und in eigenen Projekten zu verwenden. Ziel ist es, Wissen für alle Menschen zugänglich und nutzbar zu machen, unabhängig von Herkunft, Bildung oder finanziellen Mitteln. Wissenschaftliche Publikation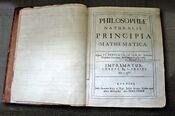 Eine wissenschaftliche Publikation ist ein Text, in dem Forscherinnen und Forscher ihre Ergebnisse, Theorien oder Beobachtungen vorstellen. Sie soll neues Wissen weitergeben und anderen ermöglichen, die Arbeit nachzuvollziehen oder zu überprüfen. Dabei wird genau beschrieben, wie die Untersuchung durchgeführt wurde und auf welche Daten oder Quellen sie sich stützt. Wissenschaftliche Publikationen sind sachlich geschrieben und enthalten keine persönlichen Meinungen. Außerdem wird immer auf frühere Forschung verwiesen, damit deutlich wird, wie die neue Arbeit in den bestehenden Wissensstand passt. Viele solcher Texte werden vor der Veröffentlichung von Fachleuten geprüft, um sicherzustellen, dass sie wissenschaftlichen Standards entsprechen. Solche Publikationen erscheinen meist in Fachzeitschriften, Büchern oder Berichten von wissenschaftlichen Konferenzen und sind wichtig, um Wissen zu teilen und weiterzuentwickeln. Liste bekannter WissenschaftenNachfolgend findest du einen Link zur Übersicht der bekannten Wissenschaftsbereiche. Schau gerne, welcher Bereich dich interessiert und in welchem du dich einbringen möchtest: Siehe auch: Wikisyntax (MediaWiki) In MediaWiki wird die sogenannte „Wikisyntax“ verwendet, um Inhalte zu erstellen, zu strukturieren und zu formatieren. Die Wikisyntax ist eine vereinfachte Auszeichnungssprache, die vom MediaWiki-System bereitgestellt wird. Sie ermöglicht es, Texte klar zu gliedern, Überschriften und Absätze zu gestalten, Listen zu erstellen, Verlinkungen zu setzen, Quellen anzugeben und Inhalte in Tabellen oder Vorlagen einzufügen. Anders als bei klassischen Programmiersprachen ist die Wikisyntax leicht erlernbar und auf das Schreiben von Inhalten fokussiert. Sie sorgt dafür, dass alle Beiträge einheitlich und übersichtlich erscheinen und dass Informationen leicht auffindbar und nachvollziehbar bleiben. Für MediaWiki ist die korrekte Anwendung der Wikisyntax besonders wichtig, da sie die Struktur und Lesbarkeit der Inhalte unterstützt und die Zusammenarbeit mehrerer Nutzerinnen und Nutzer erleichtert. Siehe auch: | ||
Auswahl wissenschaftlicher Arbeiten
- Germanen, germanische Völker, Germanien (Wissenschaft, Forschung, Lehre)
- Nanomedizin
- Prä-urknallischer Raum: Eine hypothetische KI-Simulation des Zustands vor der Entstehung von Raum, Zeit und Materie
- Künstliche Intelligenz und die Gefahr falscher Informationen
- Die Entstehung des Mondes durch die Kollision von Theia mit der jungen Erde
- Wissenschaftliche Studie über strukturelle Risiken des Kölner Doms bei hypothetischem Teilversagen eines Turmes unter Extrembedingungen (KI-Forschungssimulation)
- Der Mensch in einer Milliarde Jahren
- Künstliche Intelligenz verändert die Datierung biblischer Texte
- Jupiter (Exascale-Supercomputer)
- Neurowissenschaften und Supercomputing
- Erwachen im Eis: Wie uralte Bakterien aus dem Permafrost den Klimawandel beschleunigen könnten
- Neue Methode zur Herstellung langlebiger Immunzellen eröffnet Hoffnung bei Autoimmunerkrankungen
- Surgical Robot Transformer-Hierarchy (SRT-H)
- Quanteninternet
- Deutsche Raketenentwicklung in der europäischen Raumfahrt
- Die Gefährdung von Wissenschaft und Forschung